Analoge Blocksteuerung
für Gleich- und Wechselstrom
Sie sollte die folgenden Kriterien erfüllen:
- vorbildgetreue Modellbahn-Geschwindigkeit, für jeden Block einzeln einstellbar
- Blöcke mit Zwischen- und Schiebeloks, geschobenen Triebwagen- und Pendelzügen befahrbar
- lange Züge (bis 3.5 m)
- Auswertung der Blockbelegung
- vorbildgetreues Abbremsen bei Halt zeigendem Signal
- zuverlässiges, ruckfreies Anhalten vor dem Halt zeigenden Signal
- vorbildgetreues wieder Beschleunigen oder Anfahren bei Fahrt zeigendem Signal
- Ansteuerung der Blocksignale aus der Schaltung heraus
- Blöcke nur in einer Fahrrichtung befahrbar (kein Wechselbetrieb, da zweigleisig)
- Auswertung der Belegtmelder,
- Geschwindigkeits-Steuerung
- Einstellregler Block-Höchstgeschwindigkeit
- leistungsstarke Endstufe ( bis 10 A, keine Kurzschluss-Sicherung)
Die Blocksteuerung
Soll die Blockstrecke nur für den Betrieb mit Zugloks und kurzen Triebwagen ausgelegt werden, dann benötigt man pro Block lediglich zwei Gleisabschnitte. Diese müssen mit Belegtmeldern ausgerüstet sein und dienen als Abbrems-Strecke und Halt/Anfahr-Strecke.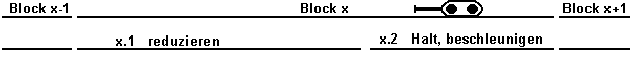
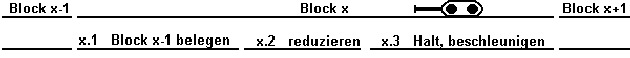
Die Auslegung der Längen der Blockstrecken muss selbstverständlich der Länge der Züge angepasst werden. Auf Anlage 4 war die Zuglänge beschränkt auf 3,50 Meter.
Grundsätzlich ist beim Abbrems- und Beschleunigungsvorgang zu unterscheiden zwischen sichtbaren und nicht sichtbaren Abschnitten. Im einsehbaren Bereich sollen Beschleunigung und Verzögerung und damit auch die Längen der Abschnitte vorbildgetreu sein.
Die Wahl der Abschnittslängen
Abschnitt x.1 muss bei Schiebebetrieb den längsten Zug fassen können. Sind nur kurze Triebwagenzüge und Zwischenloks im Einsatz, dann muss x.1 den längsten Triebwagenzug, beziehungsweise den längsten Zugteil bis zur Zwischenlok sicher fassen können.
Abschnitt x.2 soll so lange gewählt werden, dass eine vernünftige Verlangsamung des Zuges möglich ist. Auch die schnellste Lok (auch ohne Zug!) soll die Reduktionsgeschwindigkeit am Ende erreicht haben.
Abschnitt x.3 muss so lang sein, dass der Beschleunigungsvorgang auch bei schweren Zügen innerhalb des Anfahrabschnitts beendet ist.
Der Betriebsablauf
Der Betriebsablauf sieht folgendermassen aus:
Block x+1 (y) ist frei:
Fährt ein Zug in Block x ein, dann geht das Blocksignal auf Fahrt. Eine weitere Reaktion ist nicht notwendig.
Block x+1 (y) ist besetzt:
Fährt ein Zug in Blockabschnitt x.1 ein, dann bleibt das Blocksignal auf Halt. Bei der Einfahrt in Block x.2 geht die Steuerung auf Reduktion und der Zug vermindert seine Fahrt auf eine eingestellte Reduzier-Geschwindigkeit. Diese ist so eingestellt, dass die langsamste Lok mit einem schwerem Zug nicht anhält.
Bei Erreichen des Blockabschnittes x.3 reduziert die Steuerung die Geschwindigkeit in der eingestellten Zeit auf Null. (Die schnellste Lok muss sicher vor dem Signal anhalten. Halteweg ca. 10 – 30 cm)
Dass nicht alle Loks genau an derselben Stelle anhalten ist absolut vorbildgetreu.
Am Gotthard ist oftmals zu beobachten, dass Lokführer von schweren Güterzügen bei nasser Witterung weit vor dem Blocksignal die Geschwindigkeit reduzieren und sich an das geschlossene Blocksignal "herantasten", um so vielleicht einen Halt vermeiden zu können.
Der unvermeidliche Halt findet dann oftmals auf "weitere" Sichtdistanz zum Blocksignal statt.
Wird Block x+1 frei, dann beschleunigt der Zug wieder, oder er fährt an und beschleunigt auf die eingestellte Blockgeschwindigkeit.
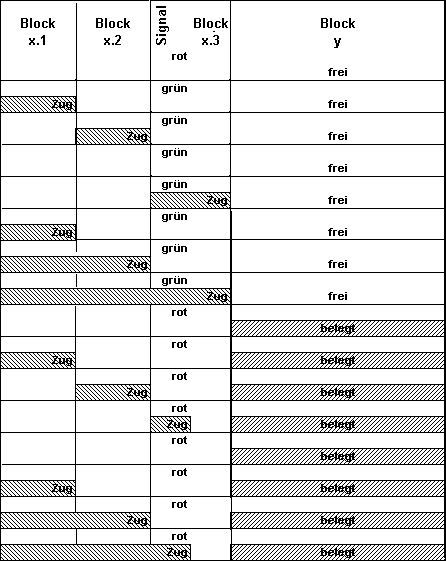
Schaltungsbeschreibung
Die Elektronik-Erfahrenen werden die Schaltung problemlos lesen können. Für die Übrigen hier eine Beschreibung der Gleichstrom-Schaltung:
Die Verstärker-Endstufe besteht aus zwei Transistoren. Den Endtransistor 3055 gibt es in zwei verschiedenen Fassungen. Soll er ebenfalls auf die Platine, dann empfiehlt sich die Fassung TIP, weil damit der Transistor aufrechtstehend am Kühlblock montiert werden kann. Der 3055 verkraftet bis 100 Watt problemlos, muss dazu aber genügend gekühlt werden.
Der 1613 erträgt immer noch 1 A. Sicherheitshalber kann auch er mit einem Kühlstern bestückt werden, es muss aber nicht sein.
Der 3055 und der 1613 bilden zusammen eine sogenannte Darlington-Schaltung und könnten durch entsprechende, vergossene Schaltungen mit gleicher Leistung ersetzt werden.
Der Kondensator C1 und der Widerstand R3 bilden zusammen ein RC-Glied. Dieses steuert den ersten Transistor T 3 der Endstufe an. R3 ist dabei auch für die Zeit-Dauer der Halt-Bremsung verantwortlich.
Die Trimmer R4, R5 sind als variable Widerstände geschaltet. Beim Nachbau empfehle ich Trimmer, welche mittels Schrauben verstellt werden. Sie sind zwar teurer, lassen sich aber feiner verstellen als die billigerenDrehtrimmer.
R4 ist zuständig für die Beschleunigung (je grösser der Widerstand, umso langsamer die Beschleunigung), R5 dient in gleichem Sinn zum Einstellen der Verzögerung. Die beiden Dioden trennen den Stromfluss für Fahren und Bremsen.
Mit dem Trimmer R8 wird die Reduktionsgeschwindigkeit eingestellt. Er bildet zusammen mit R6/R7 einen Spannungsteiler (R7 ist ein Schutzwiderstand).
Im Ruhezustand leiten die beiden Steuer-Transistoren (T1 / T2) nicht. Sie könnten problemlos durch Relais-Schalter (Schliesser) ersetzt werden.
Der Kondensator lädt sich über R4 und seine Diode auf und steuert damit die Transistorkette T3 - T5 auf. Es liegt die volle Fahrspannung U-Fahr am Gleis.
Wird Transistor T1 angesteuert (Schalter S1 geschlossen), dann entlädt sich der Kondensator über R5 und seine Diode gegen Minus. Wegen des Spannungsteilers R7/R8 und R6 kann sich der Kondensator aber nicht ganz entladen und es bleibt eine mit R8 einstellbare Spannung und damit Minimalgeschwindigkeit am Gleis.
Wird Transistor T2 angesteuert (Schalter S2 geschlossen), dann entlädt sich der Kondensator über R3 ziemlich schnell nach Minus. Die angegebene Grösse für R3 ist eine Empfehlung. Er kann problemlos etwas erhöht werden, sollte aber nie kleiner als 2,7 k sein.
Die Schaltung ist äusserst gutmütig und kann auch von Nichtelektronikern problemlos nachgebaut werden.
Um die Höchstgeschwindigkeit für jeden Block extra einstellen zu können, habe ich in die Zuleitung zum Endtransistor 3055 einen regelbaren positiven Spannungsregler eingeplant. Falls dies nicht erwünscht ist, kann dieser ganze Schaltungsteil weggelassen werden. In diesem Falle kann der Kollektor des 3055 mit dem Kollektor des 1613 zusammengeschlossen werden. (siehe Wechselstrom-Variante)
Für die Wechselstrom-Version gilt grundsätzlich dasselbe. Die einzige Änderung betrifft den Ausgang der Schaltung.
Hier wird der 3055 mit einem 1 Ohm-Widerstand zu einem elektronischenPotentiometer verbunden, welches über den Gleichrichter den Fahrstrom ans Gleis reguliert.
Der Widerstand muss unbedingt mindestens 1 Watt ertragen, besser ist mehr. Er wird heiss und sollte deshalb gekühlt werden. Mindestens ist er aber freistehend auf die Platine einzulöten. D. h. er sollte so eingelötet werden, dass er einen halben Zentimeter oder mehr über der Platine zu stehen kommt.
Für den Betrieb benutze ich zwei Spannungen. Die eine ist auf 12V stabilisiert und dient als Steuerspannung. Die andere ist nur geglättete Gleichspannung.
Die Verknüpfung der Belegt-Melder
Da bei mir die Verknüpfungs-Schaltung über TTL-ICs gemacht wird, habe ich die zwei Relais-Schalter S1 und S2 durch Transistoren ersetzt.
Ist das Blocksignal ein LED-Typ, dann können die beiden Signal-Ausgänge, bei entsprechender Wahl des ICs, direkt über den Vorwiderstand das Signal ansteuern.
Es empfielt sich aber trotzdem, als Ausgang einen Transistor oder einen Optokoppler vorzusehen.
Die Verknüpfung der drei
Belegtmelder
des Blocks x mit der Rückmeldung des folgenden Blockes y bewirken die folgenden Ausgaben:
| Block - Belegung | Ausgabe | ||||||
|
Block x
Abschnitt x.1 |
Block x
Abschnitt x.2 |
Block x
Abschnitt x.3 |
Block
x +1 (y) |
Reduktion
ein |
Halt
ein |
Signal
Hp |
Rück-
meldung y |
| frei | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zug | frei | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Zug | frei | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Zug | frei | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Zug | Zug | frei | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Zug | Zug | frei | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Zug | Zug | Zug | frei | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zug | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Zug | Zug | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Zug | Zug | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Zug | Zug | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Zug | Zug | Zug | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Zug | Zug | Zug | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Zug | Zug | Zug | Zug | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sind alle Komponenten in der Schaltung berücksichtigt, dann ergibt sich für eine analoge Gleichstrom-Bocksteuerung die im Schema gezeichnete Schaltung.
Die Wechselstrom-Version umfasst lediglich die Änderungen im Bereiche der Endstufe, gemäss entsprechendem Schaltplan für die Wechselstrom-Version.